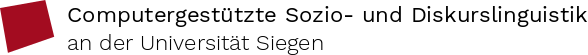Die Simulation des fremden Blicks
Die Simulation des fremden Blicks
Teil 1: „Ja, der Spiegel ist ein gar lieber Hausrath“ (Hoffmann 1827) – Spiegel-Praktiken in der Ratgeberliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts
Von Tobias Scheidt (Universität Siegen, 07.05.2020)
Spiegel gehören zu den ältesten Hilfsmitteln des Menschen, um sich ein Bild von sich selbst zu machen. Dementsprechend sind Spiegel implizit und explizit integriert in verschiedene Prozesse der Authentifizierung. Doch welche Praktiken bei einer solchen Verwendung von Spiegeln gibt es? Wo werden Spiegel benutzt und haben sich diese Stand- und Verwendungsorte im Laufe der Zeit geändert? Finden sich wiederkehrende Muster im Kommunikationsprozess mit Spiegeln? Diesen Fragen soll hier anhand ausgewählter historischer Beispiele nachgeforscht werden.
Wenn von Prozessen der Authentifizierung die Rede ist, lässt sich spekulieren, ob Spiegel auch bei regelrechten Zugangskontrollen im Sinne eines physischen Gatekeeping von Nutzen sein konnten. Für den Physiklehrer Franz Josef Pisko (1827-1888), der 1869 in der gut-bürgerlichen Zeitschrift „Die Gartenlaube“ über „Die Wunder des gewöhnlichen Spiegels“ referierte, waren verwegene Varianten denkbar: Eine Verbrecherbande könne mithilfe einer Installation von Spiegeln einen „Thürhüter“ (Pisko 1869, S. 750) für ihren Unterschlupf einrichten. Durch einen über der Haustür angebrachten Außenspiegel könne leicht überprüft werden, ob beispielsweise Gesetzeshüter oder andere unerwünschte Personen Einlass begehrten. Das Spiegelbild des Außenspiegels würde auf einen weiteren Spiegel im Innenraum reflektiert werden, so dass man im Gegensatz zu einem Türspion unbemerkt entscheiden könnte, die Tür zu öffnen oder nicht (vgl. Abbildung 1). „Solche polemoskopische[n] Spiegel-Zusammenstellungen [sollen sich] gegen lästige Besucher, zudringliche Mahner, bekannte Schuldenmacher etc. bewähren“, resümierte der Physiklehrer (Pisko 1869, S. 750).

Abbildung 1: Der Spiegel als Thürhüter (Die Gartenlaube, 1869)
Diese Konstruktion, auf der auch U-Boot-Periskope basieren, bot eine optisch-mechanische Zugangskontrolle an: Die Perspektive des menschlichen Blicks wird durch die Spiegel erweitert. Über die Funktion von Spiegeln im Prozess von Zugangskontrollen kann jedoch auch aus anderer Perspektive nachgedacht werden: Ohne Zweifel werden Spiegel auch dazu verwendet, sich ein Bild von sich selbst zu machen und die eigene äußere Erscheinung zu kontrollieren. Dient der Blick auf sein eigenes Spiegelbild nicht vorwiegend dazu, sich selbst darin zu identifizieren, um anschließend von jemand anderem erfolgreich in einer Face-to-Face-Interaktion sozialsymbolisch identifiziert zu werden (Vogel, im Druck, S. 5ff.)?
Die Herausforderung, als derjenige erkannt zu werden, der man war oder sein wollte, um eine entsprechende Behandlung zu erfahren, war der zentrale Ausgangspunkt der sogenannten Benimm- und Anstandsliteratur. Wie muss ich aussehen und auftreten, um als ein legitimer Teil der gehobenen Gesellschaft wahrgenommen zu werden? Oder in den Worten des Benimm-Handbuchs mit dem klangvollen Titel „Prof. Wenzel’s Mann von Welt“ ausgedrückt: „Wie muß unser Äußeres beschaffen seyn, wenn uns der Beyfall der Welt, die Liebe und Achtung der Menschen nicht entgehen sollen?“ (Wenzel 1825, S. 8). Die Frage nach dem Zugang zu sozialem Kapital wie Achtung, gesellschaftlichem Einfluss, Netzwerken und Beziehungen wurde von vielen Ratgebern daher zunächst auf eine Bewertung der sichtbaren Oberfläche der Individuen zurückgeführt. Denn, so heißt es weiter: „Das Äußere ist unstreitig das Erste, worauf gesehen wird, worauf die Blicke der meisten Menschen zuerst fallen. Gefällt nun dieses nicht, so ist es nur ein Ungefähr, in Gerathewohl, wenn Verstand und Tugend nach ihrem Werthe taxiert werden“ (Wenzel 1825, Vorwort, o.P.).
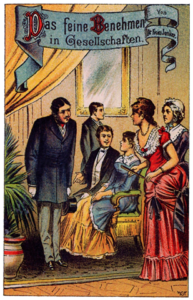
Abbildung 2: Der Spiegel als Requisite der feinen Gesellschaft: Titelbild eines Benimmratgeber von 1887
Nicht von ungefähr ziert das Titelblatt von Franz Junkers „Das feine Benehmen in Gesellschaften“ (1887) das Bild einer vornehmen Gesellschaft mit einem großen Spiegel im Hintergrund (Abbildung 2). Dies ist gleich auf mehreren Ebenen zu deuten. Einerseits standen derartig große und luxuriös-gerahmte Spiegel für einen aufwendigen Lebensstil und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse. Ferner diente metaphorisch der Benimm-Ratgeber als solcher gleich einem Spiegel der Reflektion des eigenen Auftretens und Handelns. Viele Ratgeber benutzten den älteren Gattungsbegriff des Spiegels (vgl. die so genannte Spiegelliteratur: „Fürstenspiegel“, „Sachsenspiegel“) in ihren Titel, so beispielsweise bei Friedrich von Sydows „Neuer Sitten- und Höflichkeitsspiegel“ von 1837 (vgl. auch Störmer-Caysa 2007, S. 467). Drittens gaben Benimmratgeber aber auch ausdrückliche Empfehlungen, wann, wie, wo und wozu man Spiegel einsetzen müsse, um eben ein solcher ‚Mann von Welt‘ zu sein oder sich als zugehörig zu gehobenen gesellschaftlichen Gruppen zu zeigen. Der Blick in den Spiegel geriet zur klassenspezifischen Praxis, oder anders ausgedrückt: Ein Mann oder eine Dame von Welt blickte andernorts und anders in den Spiegel als eine Landpomeranze.
Im Folgenden wird deutschsprachige Ratgeberliteratur, vor allem aus der Gattung der Benimm- und Anstandsliteratur, daraufhin untersucht, wie sie (Personen-)Spiegel als Werkzeuge des Ressourcenzugangs beschreiben und welche Praktiken des Besitzes und der aktiven und passiven Verwendung, wie Kontrolle des eigenen Aussehens und Auftretens oder der Aufbewahrungs- oder Aufstellort, sie der Leserschaft raten. Die Ausgangshypothese dieser Betrachtung ist, dass die Ratgeber Spiegel als eine Möglichkeit darstellten, den taxierenden Blick der höfischen bzw. bürgerlichen Gesellschaft auf klassenspezifisches Aussehen und Verhalten einzuüben. Über diese Simulation und Aneignung des fremden Blickes wurde nicht nur ein individueller Zugang angestrebt, sondern zugleich das dominante System der Zugehörigkeit und Ressourcenverteilung stabilisiert. Dies wird besonders am ersten Beispiel, der Hofkultur des frühen 18. Jahrhunderts, deutlich.
Wer hat die schönste Fontange im Land?
Im 18. und 19. Jahrhundert erfuhr die Qualität, Verbreitung und Verfügbarkeit von Spiegeln eine Reihe von entscheidenden Veränderungen. Mit der Entwicklung des Schmelzgussverfahrens am Ende des 17. Jahrhunderts konnten Spiegel glatter und leichter in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden, als zuvor durch das Glasblasverfahren (Gleitsmann 1985). Eingebaut in aufwendige Rahmen und in Möbeln wie Schränken stellten sie Luxusgegenstände adeliger und höfischer Inneneinrichtung dar. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden Spiegel auch in Bürgerstuben üblich (vgl. Melchior-Bonnet, 2001, S. 80f.).
Einen Einblick in diese höfische Welt gewährt das „Frauenzimmer-Lexicon“ aus dem Jahr 1715. Als Frauenzimmer konnte sowohl der Hofstaat einer Frau von Adel als auch eine einzelne Frau betitelt werden. Dementsprechend enthielt das Lexikon Einträge über nützliche Gegenstände und das übliche Inventar von Frauen vor allem höherer Stände. Unter vielem anderem behandelte das Lexikon „Juwelen und Schmuck, Galanterie, Seidne, Wollne und andere Zeuge, so zu ihrer [der Frauen] Kleidung und Putz dienlich, Rauch- und Peltzwerck, Haar-Putz und Auffsatz, Schmincken, kostbare Olitäten und Seiffen“ („Amaranthes“ 1715, Titelblatt). Schon an diesem Auszug zeigt sich die enge Verbindung von Mode und standesgemäßem Auftreten. An den Höfen zur Zeit des Barock und Rokoko, wo prächtige Spiegel ohnehin als demonstrativer Konsum Zeichen fürstlicher und königlicher Macht zum Einsatz kamen (Spiegelsaal von Versailles, fertiggestellt 1684) (Melchior-Bonnet, 2001, S. 46), gewährten Spiegel zudem ein gewisses Maß an Kontrolle über das eigene Aussehen. Wie eng Hofmode an die Verfügbarkeit und ständige Nutzung entsprechender Spiegel geknüpft war, zeigt auch an diesem Beispiel eine Abbildung auf der Titelseite des Frauenzimmer-Lexicons (Abbildung 3).

Abbildung 3: Der Einsatz verschiedener Spiegel im Frauenzimmer 1715
Der Kupferstich zeigt eine Frau, die von einer zweiten (wohl eine Adelige mit einer Hofdame) frisiert und mit einer Perücke oder einem Haaraufsatz versehen wird. Gleich zwei Spiegel sind in dieser Ecke des Zimmers mit dem Toilettentisch vorhanden. Mit ihrer Hilfe kann einerseits Schminke und Kopfputz leichter angelegt werden, andererseits können Bedienstete bei ihrer Arbeit überwacht werden. Die Kommunikation zwischen sitzender und stehender Person fällt darüber hinaus leichter, da über den Spiegel auch Blickkontakt hergestellt werden kann. Auf etwaige Fehlgriffe der Bediensteten kann sofort reagiert werden. Auffällig ist zudem, dass sowohl Hänge- als auch Tischspiegel in unterschiedliche Winkel geneigt sind, was jeweils einen anderen Blick, beispielsweise auch auf den ganzen Körper, ermöglicht.
Das Frauenzimmer-Lexicon enthält gleich mehrere Einträge über den Gegenstand Spiegel und differenziert sie nach Form und Funktion. Neben dem allgemeinen Artikel „Spiegel“ existiert ein eigener Eintrag unter dem Titel „Spiegel auf dem Nacht-Tisch“. Bei dieser speziellen Art des Spiegels handele es sich um einen „meistens in silberenen Rahm eingefaste[n] Spiegel, so von hinten aufgestellet werden kan, vor welchen sich das Frauenzimmer ihren Haar-Putz und Fontagen aufzustecken und aufzusetzen pfleget.“ („Amaranthes“ 1715, Sp. 1880). Aufgrund dieses Einsatzfeldes würden diese Spiegel auch „Auffsetze-Spiegel“ genannt (ebd.). Sie standen also in einer engen Verflechtung zu einer speziellen Mode am Hofe. Andere Lexika des 18. Jahrhunderts erwähnen darüber hinaus auch noch kleinere „Taschenspiegel“ (Zedler 1743, Sp. 1584), die im Schubsack, also tiefen Taschen in der Kleidung, ständig mitgeführt werden konnten. Das Tragen von Perücken und Frisuren-Aufsätzen („Fontangen“) galt als Ausweis der Zugehörigkeit zu einem Hof. Derartige Spiegel kamen also nur für die Angehörigen einer sozialen Gruppe in Frage. Der Zugang zur Hofmode war zudem in Kleider- und Ständeordnungen festgeschrieben. Diese sprachen Privilegien und Restriktionen aus, limitierten Kleidungsarten, Materialien und deren Verarbeitung und ordneten sie gesellschaftlichen Gruppen zu. Über die Wirksamkeit dieser Kleiderordnungen im Alltag geben historische Forschungen ein differenziertes Urteil: Bewusstes Zuwiderhandeln geschah in der Absicht, sich die Kleidungszeichen eines höheren Standes anzueignen. Selbst ärmere, ländliche Schichten versuchten damit, gezielt die soziale Zuordnung zu verändern (vgl. Medick 1997, S. 392ff.). Verstärkt durch diese Ordnungen, drückte Kleidung also Zugehörigkeiten aus (vgl. Dinges 1993), die Trägerinnen und Träger wurden lesbar. Oder, um es mit Georg Simmel zu sagen: Die Mode „ergänzt die Unbedeutendheit der Person […] durch die Zugehörigkeit zu einem durch eben die Mode charakterisierten, herausgehobenen, für das öffentliche Bewußtsein irgendwie zusammengehörenden Kreis“ (Simmel 1905, S. 25).
Stellte die Hofmode also ein „bloßes Erzeugnis sozialer Bedürfnisse“ (Simmel 1905, S. 10) dar, die durch Hochsteckfrisuren, Perücken und Fontangen keine praktischen Bedürfnisse erfüllte sondern Zugehörigkeit ausdrückte, verbesserten Spiegel erstens die Möglichkeit des korrekten Anlegens von Kleidung und Kopfputz und ermöglichten zweitens Interaktion und Kontrolle mit und über Bedienstete, die diese Arbeiten durchführten oder dabei assistierten. Oberste Maßgabe war die Kontrolle über das eigene äußere Erscheinungsbild und damit die Zugehörigkeit zur Hofgesellschaft zu demonstrieren und einen entsprechenden Zugang zur gesellschaftlichen Elite zu erhalten.
Die Garderobe als Kontrollschleuse zur Öffentlichkeit
Die Kontrolle über das eigene Aussehen zu bewahren, spielte nicht nur in der höfischen Gesellschaft des 18. sondern auch im gehobenen Bürgertum des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle, um den Zugang zu finden. Benimmratgeber und Anstandsliteratur gaben auch Anweisung, wo im Haushalt Spiegel anzubringen oder aufzustellen seien. Flure und Vorräume wie die Garderobe dienten nicht nur dazu, Mäntel und andere Straßen- und Reisekleidung an- und abzulegen, sondern sich auch vor einem Spiegel herzurichten. So skizzierte Franz Ebhardt in seinem Handbuch „Der gute Ton in allen Lebenslagen“ von 1889 den Empfang der Gäste bei einer halböffentlichen Abendveranstaltung folgendermaßen: „Die Hausfrau hat dafür gesorgt, daß im Vorraum ein Spiegel nebst Steck- und Haarnadeln, sowie eine Bürste etwaigen Toilettenbedürfnissen der Ankommenden Hilfe bietet“ (Ebhardt 1889, S. 326). Seine Leserinnen beruhigte Ebhardt auch mit der Aussage, dass eine entsprechende Schleuse zur Selbstkontrolle und der (Wieder-)Herstellung des gewünschten – und damit als angemessen antizipierten – Erscheinungsbildes auch im öffentlichen Raum des Theaters üblich sei. Dort befände sich ebenfalls ein „Spiegel, um das Haar vor dem Eintritte in den Saal wieder völlig in Ordnung zu bringen“ (Ebhardt 1889, S. 504). Dienten diese im (halb-)öffentlichen Raum angebrachten Spiegel also dazu, einen gewünschten Zustand nach einer Anfahrt wiederherzustellen, empfahlen Ratgeber die Benutzung von Spiegeln auch zu anderen Übungen, die jedoch abgeschirmt von fremden Blicken im Privaten durchgeführt werden sollten.
Die Simulation des fremden Blickes
Zur visuellen Wahrnehmung (und damit auch Bewertung) einer Person gehört nicht nur das Erscheinungsbild sondern auch deren Mimik, Gestik und Bewegungsabläufe. Zu den komplexen Bewegungsroutinen, die zugleich ein Ausdruck der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen wie der Anerkennung eines hierarchischen Verhältnisses gegenüber anderen Gruppen und Individuen waren, gehörten Verbeugungen. Diese galten gemeinhin als Zeichen des Respekts. Liest man die Ratgeber des 19. Jahrhunderts jedoch etwas ‚zwischen den Zeilen‘, wird rasch deutlich, dass es um mehr ging als eine reine Ehrbezeugung:
„Schwieriger als für den Herren sind die Vorschriften einer regelrechten Verbeugung für die Dame, denn hier ist es mehr als eine bloße Verbeugung. […] Wer das nicht in der Tanzstunde gelernt hat, mag es vor dem Spiegel sorgfältig üben, denn es ist keine Frage, daß diese Verneigung, wenn sie graziös ausgeführt wird, dem Körper eine unbeschreibliche Anmut verleiht.“ (Ebhardt 1889, S. 274)
Erhellend ist hier besonders die Differenzierung der Geschlechter: Die Verbeugung der Damen hat das Potenzial, „graziös“ und „anmuthig“ zu sein und damit einem gesellschaftlich erwünschten Bild nahe zu kommen. Dabei schien es wichtig zu sein, diese Fähigkeiten und Bewegungsroutinen entweder in einem akzeptierten, institutionellen Rahmen gelernt zu haben (Tanzschule), oder sich im privaten Raum angeeignet zu haben. Der Blick in den Spiegel beim Üben sollte den Blick des Gegenübers oder anderer Beobachter bei einer öffentlichen Vorführung der Verbeugung vorwegnehmen.
Ähnliche Empfehlungen fanden sich auch in Ratgeberliteratur für Männer. So war „Prof. Wenzel’s Mann von Welt“ aus dem Jahr 1825 zu entnehmen, dass sowohl Blicke und Mienen als auch Körperstellungen und Bewegungen eine „Veredelung“ (Wenzel 1825, S. 10) oder „Cultur“ (S. 32) erfahren müssten, damit die ganze Person „den Beyfall der Menschen“ (S. 35) erhalte und das edle Innere auch äußerlich sichtbar sei. Um dies zu erreichen müssten
„Wendungen und Bewegungen natürlich werden, […] wir [müssen] uns nothwendig häufig in denselben üben, damit sie nachher, wenn wir reden, gleichsam von selbst in unsere Hände kommen, ohne daß wir weiter an ihre Regeln denken dürfen. Wir müssen sie erst so lange wiederhohlt haben, bis wir mit der Art, uns zu benehmen, ganz vertraut worden sind, so zwar, daß niemand uns die Mühe ansehe, die wir uns deßhalb gegeben haben.“ (Wenzel 1825, S. 58)
Wenzel adressiert hier eine Problemlage, die der französische Soziologe Pierre Bourdieu 1979 in das Zentrum seiner Studie über die „Feinen Unterschiede“ rückte: Den Autodidakten, der nicht schon von Hause aus die ‚richtigen‘ Kulturtechniken gelernt und sich den entsprechenden Habitus angeeignet hat, begleitet stets das Risiko, dass man ihm das mühevoll angelernte und das Fehlen einer ungewussten Natürlichkeit anmerkt und er quasi als Hochstapler auffliegt (vgl. Bourdieu 1987, S. 56). Wenzel empfahl daher, zunächst in einen Spiegel zu schauen, um zu erfahren, „was an uns fehlerhaft ist, woran es noch gebreche“ (Wenzel 1825, S. 39). In einem nächsten Schritt solle man entsprechende Übungen zur Verbesserung allein vor einem Spiegel oder vor einem gebildeten, kritischen Freund durchzuführen:
„Durch die Nachahmung des Empfehlenden an Andern, und durch Hülfe der Kritik, die uns unser Freund nicht vorenthalten, und gegen welche uns die Eigenliebe im Spiegel nicht unempfindlich machen darf, werden wir bald unserer Physiognomie den Ausdruck eines veredelten Herzens und Verstandes geben.“ (Wenzel 1825, S. 40)
Für Wenzel ist entscheidend, den eigenen Blick auf sich im Spiegel zunächst zu entfremden, da eine natürliche Eigenliebe ansonsten kein Verbesserungspotenzial offenlegen würde. Erst durch die Simulation eines fremden Blickes im Spiegel, bei der man beispielsweise mit dem Spiegel spricht und die Bewegungen anderer nachahmt (vgl. Wenzel 1825, S. 58), kann der Spiegel zum Werkzeug der Selbstverbesserung werden. Ziel war eine Natürlichkeit im höflichen und galanten Verhalten gegenüber dritten Personen, die den autodidaktischen „Mann von Welt“ als einen der ihren wahrnehmen sollten.
Dennoch gibt es in den Ratgebern relativ wenig direkte Instruktionen oder Empfehlungen zur Verwendung von Spiegeln. Wenn Hoffmann in seinem Ratgeber vor dem Typus der eitlen jungen Dame warnt, die vor dem Spiegel „[s]tundenlang simulirt […], ob die eine Locke schief oder gerade seyn […] soll“ (Hoffmann 1827, S. 122), sind dies keine ethnologischen Beschreibungen, sondern diskursive Figuren. Die historische Spiegelnutzung als performative Praxis bleibt in dieser Quellengattung unterbeleuchtet, weil sie schon aus der Sicht der Zeitgenossen wenig erklärungsbedürftig erschien. Was jedoch in den Benimmbüchern zur Sprache kommt, waren Risiken, die von Spiegeln ausgingen. Und damit sind nicht jene Gefahren für Leib und Leben gemeint, vor denen ein Bauernkalender 1803 warnte: Die Metallbeschichtung von Spiegeln könne bei Blitzeinschlägen in tödliche Splittergeschosse zerbersten, weswegen man sich bei Gewittern besser nicht in der Nähe von Spiegeln aufhalte (Anon. 1803, S. 108). Schon der oben zitierte Hinweis, die ‚Eigenliebe‘ solle den Betrachter des Spiegels nicht ablenken, war als ein Hinweis zu verstehen, dass Spiegeln auch eine regelrecht kontraproduktive Wirkung zugeschrieben werden konnte. Zu wissen, wie man Spiegel richtig benutzte, war genauso wichtig, wie zu wissen, wann man nicht in einen Spiegel schaute.
„Hinterlistige Vertraute“ – Spiegel als Bedrohung des ‚authentischen‘ Mannes
„Gaffe nicht in den Spiegel; blicke schnell wieder heraus, wenn ja dein Auge auf denselben fällt“ (Claudius 1800, S. 186): Mit diesen Worten mahnte Georg Claudius davor, als Gast in einem fremden Haus, mit dem Blick in dekorativen Spiegeln hängen zu bleiben und folglich die Konzentration für das Gespräch zu verlieren. Doch die Warnung vor Spiegeln erschöpfte sich in diesem Ratgeber „für Jünglinge, die mit Glück in die Welt treten wollen“ (Claudius 1800, Titelseite) aus dem frühen 19. Jahrhundert nicht nur auf Situationen gesellschaftlicher Interaktion. Ein tiefer Blick in den Spiegel barg nach Claudius für einen Mann stets die Gefahr einer „mädchenhafte[n] Eitelkeit“ anheim zu fallen und so seine Männlichkeit in den Augen anderer zu riskieren: Für Männer seien Spiegel „schlimmere, hinterlistigere Vertraute, als bey dem weiblichen Geschlecht“ (Claudius 1800, S. 17). Interaktionen mit Spiegeln sollten auf das Nötigste beschränkt werden. Der Blick in den Spiegel sollte nicht der Versicherung der eigenen Schönheit dienen, sondern um notwendige Handlungen durchzuführen. Der Spiegel wird hier pragmatisch auf ein optisches Werkzeug reduziert:
„Leider! giebt es solcher ekelhafter Jünglinge eine Menge, die sich bey der Gelegenheit, wenn sie sich [vor dem Spiegel, T.S.] die Halskrause umbinden, eine ziemliche Zeit nehmen, um nebeney ihr schönes, weißes Gesichtchen, ihre Augen, ihre Zähne bewundern zu können.“ (Claudius 1800, S. 17)
Schon die Verwendung des Diminutivs weist hier darauf hin, dass es mit der Männlichkeit der „ekelhaften Jünglinge“ in diesem Negativbeispiel weit her war. Hier fand eine Aushandlung des Männlichen statt. Hier scheint die alte Gleichsetzung des Spiegelsymbols mit der Todsünde der „Superbia“ durch, die als eine ausgesprochen weibliche Untugend galt: „Eitelkeit [liegt] viel seltner im Charakter des Mannes!“ postulierte Hoffmann 1827 (S. 118). Viele Benimmratgeber des 19. Jahrhunderten betrachteten die häufige männliche Nutzung von Spiegeln als schädlich und einen Weg, sich der Lächerlichkeit preiszugeben (vgl. York 1893, S. 245f.). Eine Authentisierung als legitimer Teil einer vornehmen Gesellschaft wäre damit gescheitert (vgl. Vogel, im Druck, S. 7f.). Während Wenzel noch empfohlen hatte, Mimik und Bewegungen vor einem Spiegel zu erproben, lehnte Christian Birch in „Der Mensch in der Gesellschaft“ solche Übungen komplett ab:
„[M]an studire sich ja nicht ein vor dem Spiegel; das führt fast immer zu einer Art von Äfferei; aber damit äfft man nur sich selbst und nicht Andere. Vor Allem hüte man sich, in Gesellschaft etwa im Spiegel die Wirkung des äußern Erscheinens erforschen zu wollen […].“ (Birch 1847, S. 89)
Auch an dieser Stelle wird wieder gewarnt, sich in der Öffentlichkeit in einem Spiegel zu betrachten. Zudem kann eine Verschiebung beobachtet werden: Dienten die barocken Spiegelsäle noch dazu, die höfische Pracht der Kleider und Ausstattungen zu vervielfältigen und für alle Augen sichtbar zu machen, wurde der öffentliche Blick in den Spiegel nun geächtet. Die Simulation der eigenen Wirkung auf andere hatte – wenn überhaupt – unbeobachtet stattzufinden. Unter den Blicken dritter, war die Erprobung im Spiegel nur ein Ausdruck der eigenen Eitelkeit oder gar Künstlichkeit (vgl. auch Hoffmann 1827, S. 120). Birch empfahl daher, auf das Risiko zu verzichten, und lieber den direkten Kontakt bereits arrivierter Persönlichkeiten zu suchen:
„[M]an [beobachte] den Eindruck, den man auf anstandsvolle und verständige Personen hervorbringt; wenn diese unserer äußeren Person keine besondere Aufmerksamkeit zuwenden, sondern nur beachten was wir sagen, so kann man gewiß seyn, daß man nichts Unschickliches an sich hat.“ (Birch 1847, S. 89)
Für Birch drückte sich ein Erfolg regelrecht in der Nichtbeachtung der Äußeren aus: Nur die sprachlichen Äußerungen sollen Beachtung und Lob finden. Der Autor beschwört damit eine auf das innere bedachte Haltung auf, die kulturgeschichtlich und besonders in Zeiten der deutsch-französischen Rivalität als ‚deutsche Innerlichkeit‘ beschrieben worden ist. Für den Soziologen Norbert Elias handelte es sich dabei jedoch vor allem um einen sozialen Konflikt: Identitätsbildend für das mittelständische Bürgertum in Deutschland war die Bildung, während die französisch-geprägte höfische Kultur, zu der es keinen direkten Zugang hatte, künstlich galt (vgl. Elias 1997, S. 120).
Fazit
Um die Stimmung auf einer Abendveranstaltung fröhlich zu halten, empfahl Johann Traugott Schuster einem angehenden „Galanthomme, oder der Gesellschafter, wie er sein soll“ Anekdoten zum Besten zu geben, zu denen er auch die folgende empfahl:
„Eine bejahrte Dame, deren Teint durch den Einfluß der Zeit gelitten hatte, rief vor dem Spiegel aus: ‚Ja, sonst waren die Spiegel weit besser. Heut zu Tage zeigen sie bei weitem nicht so ähnlich, wie ehedem.‘“ (Schuster 1842, S. 213)
Der Witz derartiger Anekdoten konnte nur aufgehen, indem er auf allgemein Bekanntes rekurrierte. Tatsächlich existierten breite Qualitätsunterschiede in der Spiegelfertigung, wobei sich im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa bestimmte Fertigungstechniken durchsetzten, die eine hohe Güte bei der Reflektion erreichten. Darüber hinaus wurde der regelmäßige Blick in den Spiegel als typisch weiblich codiert. Der Witz funktioniert jedoch nur, weil allgemein vorausgesetzt wird, dass Menschen in Spiegeln sich selbst wiedererkennen und dieses Abbild als alter ego akzeptieren. Spiegel dienten, sich zu versichern, dass die Vorstellung vom eigenen Aussehen mit der tatsächlichen äußeren Erscheinung in Einklang stand. Eine Betrachtung von Benimm- und Anstandsratgebern des 18. und 19. Jahrhunderts zeigt jedoch, dass diese selbst-identifizierende Blickpraxis komplex im Spannungsfeld von Privatheit und Öffentlichkeit eingebettet war. Der Standort eines Spiegels und die beteiligten Akteure bestimmten, welche Praktiken der Selbstanschauung als angemessen galten. So waren zweifellos prüfende Blicke in den Spiegel unproblematisch, wenn es darum ging, das Handwerk von Barbieren, Friseuren oder Schneidern am eigenen Leib zu überprüfen. Als Innenraumdekoration waren Spiegel nicht nur in Palästen sondern auch in Bürgerstuben weit geschätzt, da ihnen auch noch in Zeiten der Massenfertigung der Luxus vormaliger Seltenheit anhaftete. Um diese Ausnahmen näher zu beleuchten, bietet die neuzeitliche Ratgeberliteratur jedoch nur wenige Anhaltspunkte. Sich öffentlich in einer spiegelnden Oberfläche selbst zu betrachten, erklärten viele Ratgeber zu einer regelrechten Bedrohung von Männlichkeit. So suggerieren viele Höflichkeitsbüchlein, dass in der auf Ernsthaftigkeit und persönlicher Ehre bedachten bürgerliche Gesellschaft, ein falscher Blick in den Spiegel einer statusgefährdenden Blamage gleichkam: „Lieber Neid und Bosheit, selbst Haß ertragen – nur nicht der Lächerlichkeit anheimfallen!“ (York 1893, S. 245).
Literatur
- „Amaranthes“ (1715): Nutzbares, galantes und curiöses Frauenzimmer-Lexicon. Leipzig: Joh. Friedrich Gleditsch und Sohn:
- Anon. (1803): Vorsicht bey herannahenden Gewittern. In: Neuer hundertjähriger Bauernkalender vom Jahre 1803 bis 1903. Grätz: Johann Andreas Kienreich.
- Birch, Christian (1847): Der Mensch in der Gesellschaft, oder die Kunst des Umganges mit Menschen. Stuttgart: Verlags-Bureau.
- Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Claudius, Georg C. (1800): Kurze Anweisung zur wahren feinen Lebensart. Nebst den nöthigen Regeln der Etikette und des Wohlverhaltens in Gesellschaften für Jünglinge, die mit Glück in die Welt treten wollen. Leipzig: Böhme.
- Dinges, Martin (1993): Von der „Lesbarkeit der Welt“. Zum universalisierten Wandel durch individuelle Strategien. Die soziale Funktion der Kleidung in der höfischen Gesellschaft. In: Saeculum 44, S. 90-112.
- Ebhardt, Franz (1889): Der gute Ton in allen Lebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr in der Familie, in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben. 11. Auflage. Leipzig/Berlin: Julius Klinkhardt.
- Elias, Norbert (1997): Über den Prozeß der Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Gleitsmann, Rolf-Jürgen (1985). Die Spiegelglasmanufaktur im technologischen Schrifttum des 18. Jahrhunderts. Eine Studie zur Technologie des Manufakturwesens in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Themenkomplexes Glasschmelzofenkonstruktionen. Düsseldorf: VDI Verlag.
- Junker, Franz (1887): Das feine Benehmen in Gesellschaften. Styrum, vorm. Oberhausen: Verlag von Ad. Spaarmann).
- Medick, Hans (1997): Weben und Überleben in Laichingen 1650-1900. Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte. 2. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Melchior-Bonnet, Sabine (2001): The Mirror. A History. London/New York: Routledge.
- Pisko, Franz Josef (1869). Die Wunder des gewöhnlichen Spiegels. In: Die Gartenlaube, S. 749-752.
- Schuster, Johann Traugott (1842): Galanthomme oder der Gesellschafter, wie er sein soll. Quedlinburg: Ernst’sche Buchhandlung.
- Simmel, Georg (1905): Philosophie der Mode. In: Moderne Zeitfragen (11), S. 5-41.
- Störmer-Caysa, Uta (2007): Spiegel. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 3. P-Z. Berlin/New York: de Gruyter, S. 467-469.
- Sydow, Friedrich von (1837): Neuer Sitten- und Höflichkeits–Spiegel. Ein Complimentirbuch für alle Stände. Nordhausen: Müller.
- Vogel, Friedemann (im Druck): Authentifizierung – Grundlagen einer Theorie zu sozialsymbolischen Praktiken der Identifizierung und Zugangskontrolle. In: Felder,Ekkehard/Gardt, Andreas (Hg.): Authentizität zwischen Wahrhaftigkeit und Inszenierung? Antworten aus gesellschaftlichen Handlungsfeldern.Berlin/Boston: de Gruyter (Open Access).
- Wenzel, Gottfried Immanuel (1825): Prof. Wenzel’s Mann von Welt, oder dessen Grundsätze und Regeln des Anstandes, der feinen Lebensart, und der wahren Höflichkeit, für die verschiedenen Verhältnisse der Gesellschaft. 8. Auflage. Pesth/Leipzig: Hartlebens Verlag.
- York, B. von (1893): Lebenskunst. Die Sitten der guten Gesellschaft auf sittlich ästhetischer Grundlage. Ein Ratgeber in allen Lebenslagen. Leipzig: Adalbert Fischers Verlag.
- Zedler, Johann Heinrich (Hrsg.) (1743): Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, Bd. 38: Sk-Spie. Leipzig/Halle: Johann Heinrich Zedler.
Über den Autor
Tobias Scheidt studiert an der Universität Siegen. Er war Teilnehmer des Seminars „Sprachliche Identifizierung und Zugangskontrolle“ im Sommersemester 2019 an der Universität Siegen.